19.11.2016 00:00
Realistischer Theoretiker
und einfühlsamer Moralist
Adam Smith, der Begründer der Wirtschaftswissenschaft, wird von dieser oft falsch interpretiert - Adam Smith gilt als Begründer der Wirtschaftswissenschaften. Denn er untersuchte als Erster in systematischer Weise, wie die Konkurrenz von Produzenten, Kaufleuten und Arbeitern auf Güter- und Arbeitsmärkten und die entsprechenden Preissignale die Effizienz der Produktion steigern, die Verteilung der Einkommen zwischen Grundrente, Profit und Löhnen bestimmen und zu höherem Wohlstand führen. [Quelle: stephan.schulmeister.wifo.ac.at] JWD
Quelle des Wohlstands ist immer die Arbeit, deren Ertrag (Produktivität) durch Spezialisierung gesteigert wird, insbesondere deshalb, weil die Zerlegung eines Produktionsprozesses in immer kleinere Einzelschritte die Erfindung neuer Maschinen erlaubt. So ging die Fließbandarbeit der Entwicklung von Industrierobotern voraus.
Autor des Porträts: Stephan Schulmeister
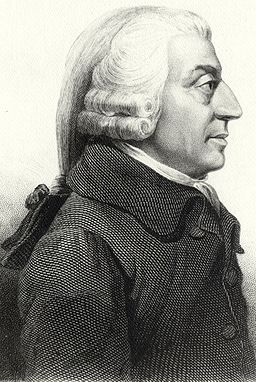
Quelle:
Wikipedia
| Zur Person: Adam Smith wurde 1720 in Schottland geboren, studierte in Glasgow und Oxford, 1752 wird er Professor für Moralphilosophie in Glasgow, seine beiden Hauptwerke „Theory of Moral Sentiments“ und (gekürzter Titel) „Wealth of Nations“ erscheinen 1759 und 1776. Besonders das zweite Werk wird ein fulminanter Erfolg und bald in mehrere Sprachen übersetzt. Smith stirbt 1790 |
Triebkraft wirtschaftlichen Handelns ist das Eigeninteresse jedes Einzelnen,
seine Lage zu verbessern. Dies fördert die Intensivierung von Tausch und
Arbeitsteilung – zwei Seiten des gleichen Prozesses – und damit die Konkurrenz.
Insgesamt bringen diese Prozesse eine stetige Steigerung des materiellen
Wohlstands.
Für das Wohlergehen einer Gesellschaft ist allerdings viel mehr nötig.
Denn ihre wichtigsten „Bindemittel“ sind Mitgefühl („sym- pathy“) und damit
soziales Verhalten. Beides begreift Smith nicht als prinzipiellen Gegensatz zu
Eigennutz:
- Meine „self-love“ wird ja auch durch die Zuneigung gestärkt, die ich
von anderen erfahre, und diese erlange ich wiederum durch meine Anteilnahme an
deren Schicksal.
Seit etwa 150 Jahren dominiert, von einem „keynesianischen Intermezzo“ abgesehen, die neoklassische Gleichgewichtstheorie. Sie nimmt an, dass Menschen rein rationale Individuen sind, deren Konkurrenz auf freien Märkten ein allgemeines Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung ermöglicht. Die Vertreter dieser Theorie behaupten, Adam Smith habe mit seiner Metapher von der „unsichtbaren Hand“ ebendies gemeint. Wie ein höheres Wesen verwandle „der Markt“ die individuellen Egoismen in das allgemeine Beste.
Tatsächlich wurde die Vorstellung einer sich selbst regulierenden Marktwirtschaft in den Gründungsvater projiziert, und zwar überwiegend erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Smith selbst hat der Metapher von einer „unsichtbaren Hand“ keinerlei „marktreligiöse“ Bedeutung beigemessen. In seinem ökonomischen Hauptwerk erwähnt er sie nur einmal, und zwar fast beiläufig.
Smith stellt fest, dass viele Kaufleute den Binnenhandel in England jenem mit den Kolonien in Übersee vorziehen, da letzterer mit viel mehr Unsicherheit behaftet sei:
- „Wenn er [jeder Einzelne] es vorzieht, die eigene nationale Wirtschaft anstatt
die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene
Sicherheit (...) Und er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von
einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er
in keiner Weise beabsichtigt hat.“
Diese Projektion hatte fatale Folgen. Der Mythos von der „unsichtbaren Hand“ bildet das Fundament jenes Prozesses der Selbstentfremdung, der seit Jahrzehnten die Gesellschaft immer tiefer in die Krise führt: Nicht die Menschen sind Subjekte, welche ihre Verhältnisse gestalten und sich dazu auch der Märkte als Instrumente bedienen, sondern „die Märkte“ werden zum steuernden Subjekt, dem sich die Menschen und auch die von ihnen gewählten Politiker zu unterwerfen haben („marktkonforme Demokratie“).
Gleichzeitig wird der Egoismus moralisch veredelt zu einem neuen „kategorischen Imperativ“: Handelst du egoistisch, so handelst du sozial und stehst im Einklang mit dem Marktgesetz. Diese Botschaft freut die Vermögenden, für ihre Verbreitung durch Think Tanks, gesponserte Lehrstühle und gekaufte Medien zahlen sie gerne.
Die großen Ökonomen nach Smith – Malthus, Ricardo, Mill oder Marx – haben sein Bild von der „unsichtbaren Hand“ nicht ein- mal erwähnt. Es passt ja überhaupt nicht zum Denkstil des großen Aufklärers: Wer Smith im Original liest, ist beeindruckt, mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit er Beobachtungen sammelt, mit wie viel psychologischer Einfühlung er Mutmaßungen über die Motive der Handelnden anstellt und wie vorsichtig er theoretische Schlüsse zieht.
Smith unterscheidet klar zwischen „selfishness“ und „self-interest“. Erstere kritisiert er scharf, letztere bewertet er als zentrale Triebkraft ökonomischen Handelns grundsätzlich positiv. Smith hat sich aber nie gegen jegliche Marktregulierung ausgesprochen. Auch zeigt er, dass die folgenschwersten Beschränkungen des Wettbewerbs von den Unternehmern ausgehen.
Wie grotesk die neoliberale Umdeutung von Adam Smith ist, wird an seinem sozialphilosophischen Hauptwerk über die Beziehungen von Individuum und Gesellschaft deutlich („Theory of Moral Sentiments“). Es bildet den Rahmen für sein (späteres) ökonomisches Hauptwerk. Smith geht es immer um das „Ausbalancieren“ gegensätzlicher Kräfte wie Leidenschaft und Moral, Emotionen und Vernunft, Eigeninteresse und Sympathie für andere, Profitstreben und soziale Gerechtigkeit, Konkurrenz und Kooperation.
Schon der erste Satz bringt diese dialektische Haltung zum Ausdruck:
- „Mag man
den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse
Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer
Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum
Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht als das
Vergnügen, Zeuge davon zu sein.“
Dies beschreibt und reflektiert Smith in einer so klugen, einfühlsamen, differenzierten und daher konkreten Art, dass einem beim Lesen Hirn und Herz aufgehen; gleichzeitig wird die intellektuelle und emotionelle Verarmung der Mainstream-Ökonomen bedrückend klar.
Wie groß das Vergnügen sein kann, anderen zu helfen, wurde im vergangenen Herbst deutlich. Viele vom „Train of Hope“ am Wiener Hauptbahnhof sprachen lachend über die „euphorisierende“ Wirkung des gemeinsamen Helfens.
Nach Smith prüft jeder Mensch sein Verhalten vom Standpunkt seines inneren „unparteiischen Beobachters“ und stimmt es so auf jenes der anderen ab. Denn der „innere Mensch“ repräsentiert die Normen der Ethik. Diese sind bei Smith nicht aus einem abstrakten „Sittengesetz“ abgeleitet, sondern aus dem konkreten Bedürfnis von Menschen, zu lieben und geliebt zu werden: „Wo jener notwendige Beistand aus wechselseitiger Liebe, aus Dankbarkeit, aus Freundschaft und Achtung von einem Mitglied dem anderen gewährt wird, da blüht die Gesellschaft und da ist sie glücklich.“
Wird dieser Idealzustand nicht erreicht, so braucht es zumindest Gerechtigkeit. Sie ist „der Hauptpfeiler, der das ganze Gebäude stützt. Wenn dieser Pfeiler entfernt wird, dann muss der gewaltige, der ungeheure Bau der Gesellschaft (...) in Atome zerfallen.“
Bedroht wird die Gerechtigkeit durch „selfishness“, also durch Unterdrückung der Mitmenschlichkeit. Ein solches Verhalten muss durch den Staat eingeschränkt werden, indem etwa Vorschriften den Mitbürgern „bis zu einem gewissen Grade auch gegenseitige gute Dienste anbefehlen“. Gegen den späteren Sozialstaat hätte Smith wohl nichts gehabt.
Die neoliberalen „master minds“ werden ihren „Urvater“ wohl nur sehr selektiv gelesen haben.
Link zum Originaltext bei ' stephan.schulmeister.wifo.ac.at ' (PDF)..hier
Zum Autor: Stephan Schulmeister ist Wirtschaftsforscher und Universitätslektor in Wien
| << zurück | Home | | Tags: Wirtschaftssystem, Neoliberale Irrtümer, Adam Smith, Stephan Schulmeister, Ökonomie, unsichtbare Hand, selfishness, self-interest, Sozialstaat, Theory of Moral Sentiments |